Gesundheit stärken und heilen statt öfter erkranken und Krankheit bekämpfen
Heilpflanzen - wesensgemäß anwenden
DER Heilpflanzenblog für alle, die mit Heilpflanzen vertraut(er) werden wollen
Bitte informiere mich, wenn neue Artikel erscheinen
Bitte informiere mich, wenn neue Artikel erscheinen
Heilpflanzen dieser Website ">" heißt: Portraits verfügbar | vermittelte Qualität, Wesen (Mouse-over zeigt Indikationen) |
|---|---|
Zerschlagenheit | |
Sichbewahren, Ernst, Bestimmtheit | |
Antioxidanz | |
Gesundheit stärken und heilen statt öfter erkranken und Krankheit bekämpfen
Seite [tcb_pagination_current_page] von [tcb_pagination_total_pages]
Die besten Bücher zu Heilpflanzen und zur ganzheitlichen Pflanzenheilkunde
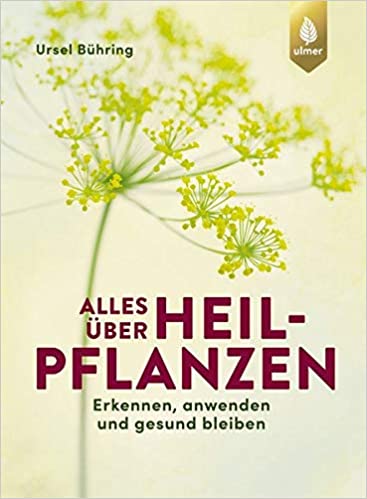
Eines der schönsten, modernsten, kompetentesten und best aufgemachten Bücher über Heilpflanzen, inzwischen in der 5. Auflage. Für Laien, als Nachschlagewerk, für Neugierige, für alle, die sich für Heilpflanzen interessieren oder die Welt der Heilpflanzen kennen lernen wollen.
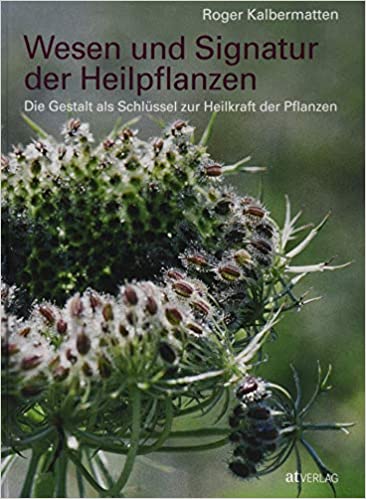
Ein revolutionäres Buch, das erstmals sich nicht auf eine botanische Beschreibung von Heilpflanzen stützt, sondern ihr Wesen darlegt. Für viele geht bei der Lektüre ein Licht auf. Es ist ein Buch, um sich in Heilpflanzen zu verlieben. Auch Ursel Bührungs Buch ist von R. Kalbermatten mit inspiriert.
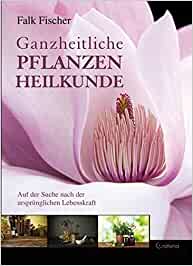
Ein philosophisches Werk (mein eigenes), das sich im Spiegel einer ganzheitlichen Pflanzenheilkunde auf die Suche nach einem wirklichen Lebensverständnis begibt. Es spannt den Bogen von der Quantenphysik bis hin zur Alchemie und geht der Frage nach, wie sich Lebendiges organisiert und was es so anders macht, Lebendiges mit (zubereitet) Lebendigem zu heilen.
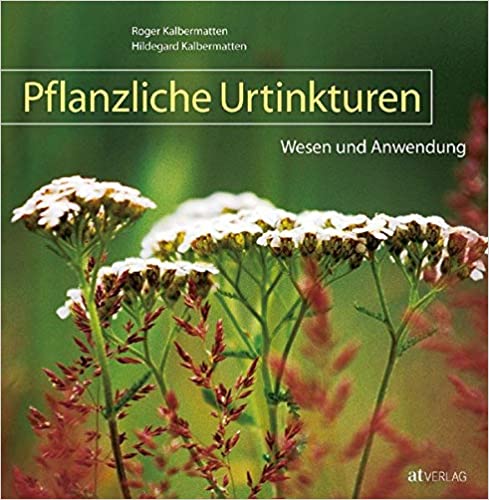
Roger Kalbermatten ist Begründer der Ceres Heilmittel AG und hat durch seine neuartige Pflanzenbetrachtung gleich auch ein darauf ausgerichtetes Herstellungsverfahren entwickelt. Dieses Buch ist ein praktisches Anwendungsbuch (abgestimmt auf die - hervorragenden - Ceres-Tinkturen). Prägnant, übersichtlich, für Laien ideal, die gerne auf Selbstbehandlung mit Heilpflanzen setzen.